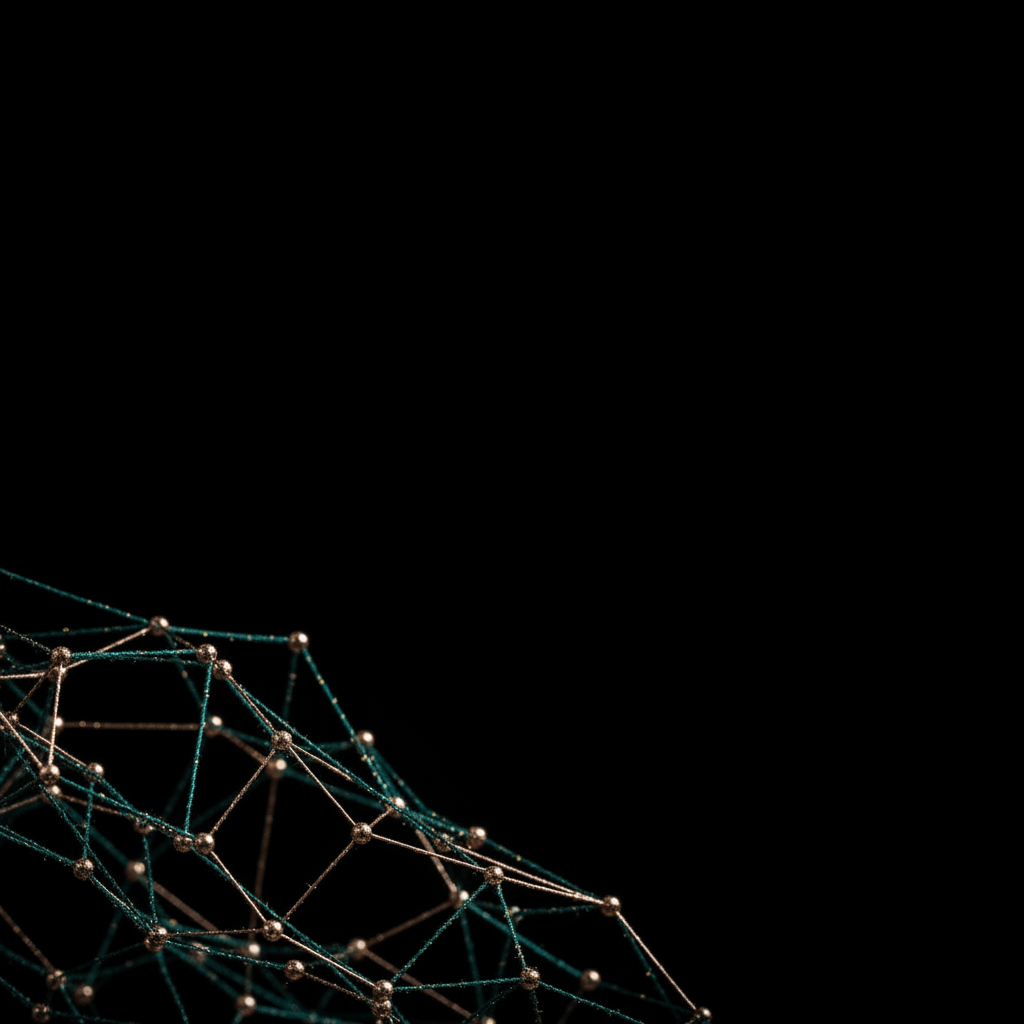1. Warum First-Party-Daten Chefsache sind
Kundenzentrierung beginnt mit einer einfachen Frage: Wem gehören die Daten? In einer Ära, in der Plattformen sich abschotten und Cookies verschwinden, wird der Besitz eigener, sauber erhobener Daten zur strategischen Notwendigkeit. First-Party-Daten sind das direkte Feedback Ihrer Zielgruppe – unverfälscht, freiwillig und DSGVO-konform.
Sie sind nicht irgendein Datenschatz. Sie sind die Grundlage für nachhaltige Kundenbeziehungen, für relevante Kommunikation und für die digitale Souveränität Ihres Unternehmens.
2. Was First-Party-Daten ausmacht
First-Party-Daten entstehen im direkten Kontakt mit Ihrer Marke. Sie stammen aus:
- der Nutzung Ihrer Website (z. B. Produktinteresse, Interaktionsverhalten)
- Formularen und Anfragen (z. B. Themen, Interessen, Dringlichkeiten)
- Newslettern (z. B. Präferenzen, Reaktionen, Klickverhalten)
- CRM-Systemen (z. B. Historie, Touchpoints, Segmentzugehörigkeit)
- Veranstaltungen und Webinaren (z. B. Teilnahme, Feedback)
Sie zeigen nicht nur, wer Ihre Kund:innen sind – sondern auch, was sie bewegt. Und: Sie gehören Ihnen. Nicht Google. Nicht Meta. Ihnen.
3. Was sind Third-Party-Daten – und warum verlieren sie an Relevanz?
Third-Party-Daten stammen nicht aus der direkten Beziehung zwischen Unternehmen und Kund:innen. Sie werden von Drittanbietern aggregiert, meist ohne unmittelbaren Bezug zur Marke. Beispiele:
- Cookies von Werbenetzwerken, die Nutzerverhalten über viele Websites hinweg verfolgen
- Datenpakete von Data Brokern, etwa zu Kaufkraft, Interessen oder Standortclustern
- Social-Media-Daten über Zielgruppen, gesammelt durch Plattformen wie Facebook oder TikTok
Wie wurden sie genutzt? Etwa so:
- Ad-Targeting: Wer sich auf einer Reise-Website über Hotels informiert, bekommt später Flugangebote ausgespielt – durch Cookie-basiertes Retargeting.
- Lookalike Audiences: Plattformen wie Meta analysieren Ihre bestehenden Kund:innen und spielen Werbung an ähnliche Nutzer:innen aus.
- Programmatic Advertising: Werbekampagnen werden automatisiert auf Basis von Dritt-Daten ausgespielt – in der Hoffnung auf Streuverlust-Minimierung.
Warum das Problematisch ist:
- Mangelnde Transparenz: Nutzer:innen wissen oft nicht, wer was über sie speichert.
- Datenschutzrisiken: Zwar geben viele Anbieter an, DSGVO-konform zu arbeiten, doch oft fehlt die nachprüfbare Einwilligung der Nutzer:innen. Besonders problematisch ist das bei Third-Party-Cookies, die Nutzerverhalten ohne ausdrückliche Zustimmung über mehrere Seiten hinweg tracken. Auch sogenannte Consent-Banner sind häufig manipulativ gestaltet (‚Dark Patterns‘), um möglichst viele Zustimmungen zu erzwingen – rechtlich zweifelhaft, praktisch intransparent.
- Technologische Abhängigkeit: Sie bleiben abhängig von Plattformen und Anbietern.
- Ende der Cookies: Seit 2020 blockiert Apple in Safari standardmäßig Third-Party-Cookies (Intelligent Tracking Prevention). Google kündigte 2020 an, Third-Party-Cookies in Chrome bis Ende 2024 vollständig abzuschaffen. Gründe sind der steigende Druck durch Regulierungsbehörden (Stichwort: DSGVO, ePrivacy-Verordnung), der Vertrauensverlust der Nutzer in personalisierte Werbung und die wachsende Bedeutung von Datenschutz als Wettbewerbsfaktor. Die großen Tech-Konzerne reagieren damit auf gesellschaftliche und politische Entwicklungen – und schützen gleichzeitig ihre eigenen Ökosysteme.
4. Konkrete Anwendungsbeispiele aus der Unternehmenspraxis
In allen folgenden Beispielen gilt: Die Datengrundlage basiert ausschließlich auf First-Party-Daten – also Informationen, die direkt, freiwillig und rechtskonform von Nutzer:innen erhoben wurden. Tracking und Segmentierung erfolgen dabei im Rahmen der erteilten Einwilligung. Das ist nicht nur rechtlich erforderlich, sondern auch entscheidend für das Vertrauen der Kundschaft. Es geht nicht um Überwachung, sondern um Relevanz durch Transparenz.
a) Relevante Kommunikation statt Werberaumverschwendung
Ein Anbieter von Weiterbildungskursen analysiert das Nutzerverhalten auf seiner Website. Wer sich wiederholt für ein bestimmtes Thema interessiert, erhält eine passende Einladung zu einem Webinar – automatisiert, kontextbezogen. Die Öffnungs- und Anmeldedaten belegen: Personalisierung funktioniert. Ich selbst habe diese Art der datenbasierten Personalisierung über viele Jahre hinweg erfolgreich eingesetzt – mit Tools wie Eloqua oder Pardot, sowohl für Lead-Nurturing-Kampagnen als auch für maßgeschneiderte Webinar-Einladungen. Die Erfahrung zeigt: Relevanz entsteht nicht durch Lautstärke, sondern durch Präzision.
b) Kundenbindung durch smarte Willkommensstrecken
Ein mittelständischer Onlinehändler entwickelt automatisierte E-Mail-Strecken, basierend auf dem ersten Kauf. Wer ein bestimmtes Produkt erwirbt, bekommt nicht nur eine Bestellbestätigung, sondern eine kleine Serie mit Tipps, passendem Zubehör und echtem Mehrwert. Ergebnis: mehr Wiederkäufe – messbar im CRM. Besonders bei Xempus lag bisher immer der Fokus auf starken Willkommensstrecken, um Kund:innen möglichst früh den konkreten Nutzen des Produkts zu zeigen. Gerade für SaaS-Anbieter ist das essenziell: Die erste Produktwahrnehmung entscheidet oft darüber, ob ein Account aktiv genutzt – oder nach wenigen Tagen wieder verlassen wird.
c) Segmentierung für den Vertrieb
Ein Hersteller im B2B-Bereich strukturiert seine Leads nach Verhaltensdaten. Besuchsfrequenz, Whitepaper-Downloads und Formularanfragen fließen in ein sogenanntes Lead Scoring-Modell ein – also ein Bewertungssystem, das potenzielle Kund:innen nach ihrem Engagement und Interesse priorisiert. Moderne Systeme wie Salesforce oder HubSpot nutzen dabei zunehmend auch KI-gestützte Prognosemodelle, um anzuzeigen, welche Interessenten mit hoher Wahrscheinlichkeit zum Abschluss führen. Der Vertrieb erhält dadurch nicht nur eine Hitliste potenzieller Kund:innen, sondern echte Entscheidungshilfe: Wen anrufen, wann nachfassen, mit welchem Pitch? Kein Raten mehr – sondern datengestützte Priorisierung.
d) Produktfeedback systematisch nutzen
Ein SaaS-Anbieter integriert Supportdaten, Kündigungsgründe und Feature-Wünsche in seine Roadmap. Die Auswertung erfolgt über strukturierte Kundenfeedbacks – keine Bauchentscheidungen mehr. So entstehen Produkte, die Nutzer:innen tatsächlich brauchen.
5. Die Vorteile – konkret, nicht theoretisch
- Datenschutzkonformität: Sie arbeiten transparent, freiwillig und gesetzeskonform.
- Relevanz: Sie sprechen Ihre Zielgruppe nicht allgemein an, sondern individuell.
- Kostenkontrolle: Sie machen sich unabhängig von teuren Third-Party-Datenquellen.
- Strategische Autonomie: Ihre Datenstrategie gehört Ihnen – nicht einer Plattform.
6. Die Stolperfallen – und wie Sie sie umgehen
Viele Unternehmen besitzen bereits First-Party-Daten, nutzen sie aber nicht. Warum? Weil sie verstreut liegen. Weil sie nicht strukturiert sind. Weil es an klaren Zielen fehlt.
Ein häufiges Problem: Marketing und IT sprechen nicht dieselbe Sprache. Doch das greift zu kurz. Auch Produktteams, Customer Success und Business Development arbeiten mit (und auf Basis von) Daten – oft ohne abgestimmte Prozesse oder gemeinsame Standards. Aus meiner Erfahrung lagen selbst Marketingdaten lange isoliert vor und konnten vom zentralen Data-Team nicht sinnvoll mitgenutzt werden. Das Ergebnis: fragmentierte Erkenntnisse, doppelte Arbeit, verpasste Chancen. Dabei sind Daten längst kein rein technisches Thema mehr – sie sind geschäftskritisch und teamübergreifend relevant. Genau deshalb braucht es Ownership auf C-Level und echte Kollaboration über Abteilungsgrenzen hinweg.

7. Wie Sie eine funktionierende Strategie für First-Party-Daten aufbauen
Zielorientierung: Formulieren Sie klare Anwendungsfälle: Kundengewinnung, Upselling, Churn-Vermeidung. Daten nur zu sammeln, reicht nicht.
Datenerhebung strukturieren: Erfassen Sie, an welchen Touchpoints relevante Informationen entstehen – und wie sie sich konsistent speichern lassen.
Technologische Infrastruktur: Ein CRM, das nicht nur speichert, sondern vernetzt. Ein CDP, das segmentiert und automatisiert. Kein Selbstzweck, sondern Hebel.
Datenschutz aktiv mitdenken: Kein Vertrauen ohne Transparenz. Implementieren Sie ein sauberes Consent Management und informieren Sie Ihre Nutzer klar, was mit ihren Daten passiert.
Organisation und Kultur: Datenarbeit braucht Menschen, die sie verstehen – und Prozesse, die sie fördern. Schaffen Sie Zuständigkeiten, nicht Dateninseln.
Es geht nicht um mehr Daten. Es geht um bessere.
First-Party-Daten sind mehr als nur ein technischer Begriff. Sie sind Ihr strategisches Kapital im digitalen Marketing. Sie ermöglichen bessere Entscheidungen, relevantere Kommunikation und nachhaltige Kundenbeziehungen.
Wer sie klug nutzt, schafft Vertrauen. Wer sie ignoriert, verliert Relevanz.
Beginnen Sie heute – mit einem Ziel, einer klaren Struktur und der richtigen Haltung.
Einblicke, Ideen & Erfahrungen aus meinem Marketingalltag
In meinem Blog teile ich Ideen, Erfahrungen und Strategien aus über 15 Jahren B2B Marketing. Themen, die in echten Projekten wichtig sind: Automatisierung, CRM, Content, KI – und manchmal auch einfach nur: Klarheit. Dazu gibt’s aktuelle Studien, die helfen, den Überblick zu behalten.
- 67 Prozent investieren in künstliche Intelligenz (KI) – doch nur ein Bruchteil nutzt sie strategischWarum viele Unternehmen beim Einsatz von KI im Marketing scheitern – und wie ein durchdachter Einstieg gelingt KI im Marketing ist längst kein Trendthema mehr. Sie ist operative Realität – und der entscheidende Hebel, um mit weniger Budget mehr Wirkung zu erzielen. Laut der Forrester-Studie „Generative AI Tech Landscape, Q2 2024“ planen 67 Prozent der Unternehmen, ihre Investitionen… 67 Prozent investieren in künstliche Intelligenz (KI) – doch nur ein Bruchteil nutzt sie strategisch weiterlesen
- AI AmbassadorsAI Ambassadors: Warum Multiplikatoren aus den Fachabteilungen der Schlüssel zu erfolgreicher AI Adoption sind Letzte Woche im Weekly mit unseren 10 AI Ambassadors: Ein Engineer erklärt, wie er einen Agenten für externe Nutzer zugänglich gemacht hat. Ohne ihn hätte mich das lange Recherche gekostet. Dann zeigt jemand aus Account Management ein Tool, das ein Ambassador… AI Ambassadors weiterlesen
- Customer Lifecycle Management: Strategien für nachhaltige KundenbindungIn einer Zeit, in der Märkte gesättigt, Produkte vergleichbar und Kunden informierter denn je sind, reicht es nicht mehr, neue Kunden zu gewinnen. Wer langfristig erfolgreich sein will, muss Kundenbeziehungen strategisch gestalten – von der ersten Interaktion bis weit über den Kauf hinaus. Genau hier setzt Customer Lifecycle Management (CLM) an. Dieser Beitrag zeigt, wie ein strukturiertes, datenbasiertes… Customer Lifecycle Management: Strategien für nachhaltige Kundenbindung weiterlesen